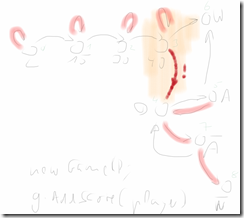Grad gibt es ja mal wieder Diskussion um eine Code Kata, die Kata Tennis. Siehe u.a. die Kommentare hier und hier. Anlass war ein online Coding Dojo der Online .NET User Group. Da gehen die Meinungen darüber, wie man am besten zu einer Lösung der Aufgabe kommt, nun auseinander. Das ist gut so. So kommen wir alle weiter, das macht grundsätzlich Spaß.
Grad gibt es ja mal wieder Diskussion um eine Code Kata, die Kata Tennis. Siehe u.a. die Kommentare hier und hier. Anlass war ein online Coding Dojo der Online .NET User Group. Da gehen die Meinungen darüber, wie man am besten zu einer Lösung der Aufgabe kommt, nun auseinander. Das ist gut so. So kommen wir alle weiter, das macht grundsätzlich Spaß.
Allerdings hat die Diskussion für mich auch unbefriedigende Züge. Sie wird nämlich mühsam, wenn wir uns nicht auf technische Aspekte konzentrieren können, weil uns unterschiedliche Ansichten zur Form im Wege stehen, genauer sogar: unterschiedliche Ansichten zum Zweck von Code Katas.
Was soll das also mit den Code Katas?
Nutzen #1: Lernen
Code Katas sind Übungsaufgaben. An ihnen soll man irgendwas lernen. Sie bieten ein überschaubares Problem ab vom Projektalltag, an dem man Techniken, Konzepte, Tools, Vorgehensweisen ausprobieren kann, ohne Angst vor Fehlern haben zu müssen. Feedback stellt sich schnell ein, weil die Aufgaben klein sind. Hat man eine Lösung zum Laufen gebracht? Hat man die Technik, das Tool, die Vorgehensweise mit Gewinn eingesetzt? Das lässt sich in wenigen Stunden herausfinden. Und wenn es Differenzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt, kann man es dann nochmal probieren mit derselben oder einer anderen Kata.
Nutzen #2: Spaß
Code Katas sind von Thema und Umfang so geschnitten, dass es Spaß macht (oder zumindest machen sollte), sich mit ihnen allein oder in Gemeinschaft zu beschäftigen. Da ist für jeden etwas dabei. Ein bisschen Knobeln, aber nicht zuviel. Der Spaß entsteht durch Herausforderung auf einem für jeden selbst wählbaren Problemniveau mit Feedback in absehbarer Zeit.
Lernen mit Spaß: Darum gehts bei Code Katas, würde ich mal sagen. Nicht mehr und nicht weniger.
 Das ist übrigens nicht neu. Solche kleinen Aufgaben gibt es schon seit Jahrzehnten. Die pragmatischen Programmierer haben sie also nicht erfunden. Da gibt es die legendären Programming Pearls von Jon Bentley. Oder den Bundeswettbewerb für Informatik, den International Collegiate Programming Contest der ACM oder hier eine wettbewerbsübergreifende Sammlung von Aufgaben.
Das ist übrigens nicht neu. Solche kleinen Aufgaben gibt es schon seit Jahrzehnten. Die pragmatischen Programmierer haben sie also nicht erfunden. Da gibt es die legendären Programming Pearls von Jon Bentley. Oder den Bundeswettbewerb für Informatik, den International Collegiate Programming Contest der ACM oder hier eine wettbewerbsübergreifende Sammlung von Aufgaben.
Wer Übungen sucht, um seine Programmierfertigkeiten zu trainieren, der findet also reichlich Material. Wie wäre es z.B. mal mit einem APL Interpreter oder Barcodeerkennung statt der ewigen Fizzbuzzpotterbankocrtennisaufgaben? Zufinden hier. Vielleicht ist da dann auch mal was dabei, was nicht so trivial ist, dass wir ewig darüber diskutieren müssen, ob TDD allein ausreicht für eine Lösung. Denn am Ende sind die bisher im Umlauf befindlichen Katas eher so klein, dass man mit oder ohne spezielle Methoden und Konzepte zu einer lauffähigen Lösung kommt.
Übrigens: Wer Spaß am Knobeln und am Wettbewerb hat, kann mit “Code Katas” sogar Geld verdienen. Einfach mal bei TopCoder vorbeischauen.
Freiheit der Form
Womit wir bei der Frage sind, was denn unverbrüchlich zu Code Katas gehört, um den Nutzen zu erreichen? Gehört TDD dazu? Gehört Modellierung dazu? Gehört eine Gruppe dazu?
Ich würde sagen, nichts davon ist zwingend. Code Katas – anders als die anderen o.g. Aufgaben – sind zwar traditionell verbunden mit TDD, doch das halte ich nicht für unverbrüchlich. TDD zu üben, war mal ein Ausgangspunkt für bestimmte Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt. Doch sich daran nun zu klammern, finde ich kontraproduktiv und dogmatisch.
Für mich ist daher die Durchführung einer Code Kata völlig frei in der Wahl der Form. Man kann sie allein oder zu mehreren im Coding Dojo bearbeiten. Man kann mit TDD oder F# oder UML oder auch ganz anders dran arbeiten. Nur der Nutzen sollte am Ende entstehen.
Minimaler Rahmen
Damit ein Nutzen sichergestellt ist, halte ich zweierlei dann aber doch für zwingend:
- Vor Beginn der Code Kata ist festzulegen, was genau gelernt werden soll. Lernziel und Erwartungshorizont sind zu definieren. Soll TDD geübt werden? Soll das Modellieren geübt werden? Soll Modellieren + TDD geübt werden? Soll die Lösung mit UML entworfen werden? Soll BDD geübt werden? Soll die Formulierung der Lösung in F# geübt werden ganz ohne Tests? Soll besonders auf SOLID oder KISS oder LOC geachtet werden? Egal. Es muss nur festgelegt werden. Ein für die Code Kata gültiger Grundsatz, ein Lernziel ist zu finden.
- Auf die Kata folgt eine Reflexion. In der wird besprochen, inwiefern der Nutzen realisiert wurde. Hatten alle Spaß? Wurden die vorher festgelegten Lerninhalte zielstrebig verfolgt? Was wurde davon gelernt? Wo gab es Schwierigkeiten? Wo wurde Unerwartetes gelernt?
Reflexion der Diskussion
Wenn ich diesen minimalen Rahmen für Code Katas mal in Anschlag bringe, sehe ich die Diskussion um die Kata Tennis ein wenig mit anderen Augen. Teile der Diskussion scheinen mir nun um ein unausgesprochenes Missverständnis zu gehen: die Lerninhalte der Diskutanten.
Über den Nutzen von Code Katas sind wir uns alle einig, glaube ich. Aber bei den Lerninhalten gehen unsere Meinungen auseinander.
Da gibt es manche, die vor allem eine Lösung finden wollen. Mehr oder weniger egal wie. Hauptsache, am Ende läuft es. Andere sind auch zufrieden, wenn keine lauffähige Lösung entsteht, es aber Spaß gemacht hat und irgendwas vorher nicht Spezifiziertes gelernt wurde. Wieder andere wollen vor allem TDD üben. Und noch andere wollen ein umfassenderes Vorgehen üben, das womöglich für die trivialen Code Katas überkandidelt erscheinen mag.
Ich denke, in zukünftigen Diskussionen über Code Katas sollten wir uns klarer darüber werden, was unsere Lerninhalte sind. Wir sollten dann Lösungen einfach so kritisieren, bei denen ein anderer als unser Lerninhalt im Vordergrund stand. “Warum hast du nur TDD benutzt?” ist nur eine valide Kritik, wenn z.B. “Softwareentwicklung üben” der Lerninhalt war, nicht jedoch wenn der lautete “TDD üben”. Kritik sollte sich entweder auf das Lernziel direkt beziehen, “Warum übst du A und nicht B?” Oder sich innerhalb des Lernziels bewegen, “Ich würde zwar B üben statt A, aber wenn du schon A verwendest, dann solltest du es anders machen.”
Vor meiner Kritik anderer Tennis-Lösungen hätte ich also z.B. erst fragen sollen, “Was war dein Lernziel, Björn?” Wenn er dann geantwortet hätte, “Ich wollte nur TDD üben.” oder “Ich wollte das State-Pattern üben.”, dann wäre meine weitere Agrumentation anders verlaufen. Dann wäre sie weniger Kritik gewesen als vielmehr schlichte Beschreibung.
So aber hatte ich angenommen, Björns Ziel sei dasselbe wie meines gewesen: “Üben, eine Lösung für ein Programmierproblem zu finden im Rahmen eines systematischen Vorgehens”. Da für mich zum systematischen Vorgehen auch Modellierung gehört, die bei Björn und anderen aber nicht sichtbar war, habe ich Kritik statt schlichter Beschreibung geäußert.
Nach ein wenig mehr Nachdenken weiß ich das nun. Zukünftig werde ich deshalb versuchen, zuerst mehr über die Ziele anderer herauszufinden. Wenn ich die kenne, kann ich entweder bewusst kritisieren, wenn ich anderer Meinung bin, oder eben nur Alternativen beschreiben. Das können alternative Ziele sein oder alternative Wege zum selben Ziel. Oder beides. Soviel als Beitrag von mir für heute zu mehr Harmonie und Frieden auf dem Entwicklererdball… :-)


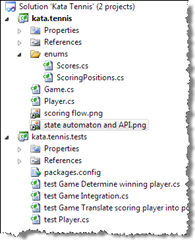 Gerade hat die
Gerade hat die